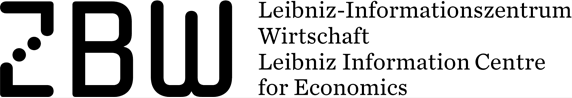Folge 53: Das Leopoldina-Papier zu Diamond Open Access
The Future is Open Science – Folge 53: Das Leopoldina-Papier zu Diamond Open Access
Dr. Doreen Siegfried
Leitung Marketing und Public Relations, ZBW – Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft
Professor Dr. Diethard Tautz
Sprecher der Arbeitsgruppe Zukunft des wissenschaftlichen Publizierens, Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina
Professor Dr. Konrad Förstner
Mitglied der Arbeitsgruppe Zukunft des wissenschaftlichen Publizierens, Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina
[00:00:00] Intro
[00:00:03] Diethard Tautz:
Jeder darf eine Zeitschrift eröffnen und danach Gebühren für die Artikel erheben, egal wie gut oder schlecht der Service ist.
[00:00:14] Konrad Förstner:
Wir verschwenden, noch mal, wie vorhin gesagt, eigentlich 40% gehen ins Shareholder Value rein, so. Und von daher sind diese 10 bis 20 Millionen, die wir jetzt erstmal initial ansetzen bzw. auch später, die Kosten dafür sind verhältnismäßig gering.
[00:00:32] Konrad Förstner:
Natürlich, man muss irgendwo anfangen und auch das wird Zeit kosten. Das ist ein Kulturwandel. Und genau das muss man irgendwann angehen und nicht die Hände in den Schoß legen und sagen, es ist jetzt einfach so.
[00:00:46] Diethard Tautz:
Wir müssen das einfach aus dem Kopf rauskriegen, dass Zeitschriften was Besonderes sind im Wissenschaftssystem. Es soll so finanziert werden, wie das gesamte Wissenschaftssystem. Und wenn man tatsächlich zu finanziellem Druck kommt, dann ist eben das gesamte Wissenschaftssystem unter Druck und nicht nur eine bestimmte Komponente.
[00:01:07] Doreen Siegfried:
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von „The Future is Open Science“, dem Podcast der ZBW. Mein Name ist Doreen Siegfried und ich treffe mich hier mit ganz unterschiedlichen Leuten aus dem Wissenschaftsbetrieb, die Ihnen verraten, wie sie in ihrer täglichen Arbeit Open Science voranbringen. Heute sprechen wir über ein Diskussionspapier der Leopoldina, das neue Wege zur Finanzierung des wissenschaftlichen Publikationswesens aufzeigt und Ideen formuliert, wie Deutschland eine Pionierrolle in der Wissenschaft einnehmen kann. Vielleicht kurz zur Einführung: Das derzeitige Publikationssystem ist stark kommerzialisiert. Große Verlagskonzerne wie Elsevier, Springer Nature und Wiley haben eine Monopolstellung und zählen zu den einflussreichsten Akteuren im Wissenschaftsbetrieb. Sie verkaufen nicht nur kostenpflichtig Zugang zur Fachliteratur, sondern bieten zunehmend auch umfassende Services entlang des gesamten Forschungszyklusses an, von der Entwicklung von Forschungsfragen über die Datenanalyse bis hin zu Publikationsmetriken und Rankings. Zudem werden die durch diese Systeme generierten Daten kommerziell verwertet. Es gibt ein Data Tracking. In diesem ganzen Geschäft entstehen Abhängigkeiten, die den Handlungsspielraum von Wissenschaftseinrichtungen einschränken. Hinzu kommt, dass dieses kommerzielle Geschäft mit der Wissenschaft mit erheblichen Mitteln staatlich subventioniert wird. Um diesen strukturellen Login zu durchbrechen und wissenschaftliche Kommunikation wieder stärker in akademischer Selbstverantwortung zu organisieren, engagieren sich verschiedene Initiativen und Konsortien für unabhängige, wissenschaftsgeleitete Zeitschriften. Und eine Arbeitsgruppe der Leopoldina hat nun zudem ein Papier vorgelegt, das neue Finanzierungsansätze formuliert. Ein Vorschlag für einen grundlegend anderen Businessplan im wissenschaftlichen Publikationssystem. Und über diese Ideen, über diese neuen Finanzierungsansätze, sprechen wir heute. Zu Gast sind Professor Dr. Diethard Tautz, Sprecher der Arbeitsgruppe Zukunft des wissenschaftlichen Publizierens und Mitautor des Papiers, sowie Professor Dr. Konrad Förstner, ebenfalls Mitglied der elfköpfigen Leopoldina Arbeitsgruppe, die sich mit diesem Thema beschäftigt hat. Herzlich willkommen!
[00:03:39] Konrad Förstner:
Hallo, danke für die Einladung.
[00:03:40] Diethard Tautz:
Hallo.
[00:03:42] Doreen Siegfried:
Warum braucht es ein komplett neues Finanzierungssystem, das über DEAL hinausgeht oder auch über bestehende Initiativen zur Diamond Open Access-Konsortialfinanzierung? Und wie genau sieht dieses Finanzierungsprinzip aus? Vielleicht steigen wir damit gleich mal ein, dass Sie das vielleicht noch mal kurz erläutern.
[00:04:07] Diethard Tautz:
Ja, das… Sie haben es schon angesprochen. Das Problem, das sich über die Jahre oder Jahrzehnte entwickelt hat, dass wir eine zunehmende Kommerzialisierung des wissenschaftlichen Publizierens sehen, weg von dem Träger der Wissenschaft, hin zu Verlagen, die eigene Initiativen entwickeln, die zum Teil ja auch sehr hilfreich sind. Da gibt es gar keinen Zweifel. Aber es hat sich eben … die Triebfeder des wissenschaftlichen Publizierens wird zunehmend kommerziell und wird damit auch sehr teuer. Gerade die großen…, die Wachstumsraten der großen Verlage und auch die Gebühren, die sie verlangen, sind, wachsen überproportional stark und gehen auch an der Wissenschaft vorbei. Es gibt dann auch Phänomene, dass manche Verlage nur entstehen, um solche Gebühren abzugreifen. Dieses Problem ist jetzt schon seit langem bekannt. Wir wollen das zurückholen in die Wissenschaft, das System, und letztlich eine institutionelle Finanzierung des wissenschaftlichen Publizierens erreichen, die genauso funktioniert wie die Wissenschaft selbst. Die gesamte Wissenschaft, öffentliche Wissenschaft, ist ja eine institutionelle Finanzierung. Basierend oft auf entweder auf direkter Förderung von Institutionen oder Forschungsinfrastruktur oder eben von Grants, die beantragt werden können. Und da wollen wir das wissenschaftliche Publizieren auch sehen, dass man einen Antrag stellen kann auf eine Finanzierung einer Zeitschrift, die begutachtet wird und damit eine Grundfinanzierung erhält, die unabhängig ist von kommerziellem Druck. Der wichtigste neue Aspekt ist tatsächlich, der bisher gar nicht realisiert worden ist, dass es auch eine Begutachtung der Zeitschriften geben soll. Das ist erstaunlicherweise bisher nicht der Fall. Jeder darf eine Zeitschrift eröffnen und danach Gebühren für die Artikel erheben, egal wie gut oder schlecht der Service ist. Und das ist tatsächlich auch nicht unter der Kontrolle der öffentlichen Hand, sondern das geht tatsächlich vorbei an normalen Vergabeverfahren. Dass die über öffentliche Ausschreibungen, zum Beispiel, kontrolliert werden. Und das ist eben unsere Idee. Man bekommt einen Etat, mit dem man auch wieder Verlage beauftragen kann, aber eben über eine öffentliche Ausschreibung. Damit ist eben die beste Kontrolle über die Ausgaben gesichert.
[00:06:43] Doreen Siegfried:
Okay. Also das heißt, es wird nicht nur wie bislang… Also es wird nicht nur das wissenschaftliche Ergebnis, die Forschungspublikation, bewertet, die letztlich in der Zeitschrift angeboten wird, sondern auch die komplette Infrastruktur. Das, was Sie jetzt als Service nannten, soll bewertet werden.
[00:07:00] Diethard Tautz:
Genau. Also, dass, die Qualität der Zeitschrift wird bewertet und das gibt eben auch eine neue Dimension, wie man eben die Qualität der Zeitschriften abschätzen kann, unabhängig von einem Impact Factor, der ja auch sehr stark in der Diskussion ist, ob das der korrekte Weg ist, die Qualität einer Zeitschrift abzuschätzen. Ist eigentlich der wissenschaftliche Weg ist eigentlich, eine Begutachtung der Zeitschrift zu machen.
[00:07:22] Doreen Siegfried:
Welche Vorteile sehen Sie denn darin, hinsichtlich oder im Vergleich zu bereits bestehenden Open-Access-Formaten?
[00:07:31] Konrad Förstner:
Also wir haben das, wir haben das ja gesehen, dass der goldene Weg, der sich in den letzten Jahren durchgesetzt hat, eigentlich ausgenutzt wird von den kommerziellen Verlagen. Das heißt, wir haben da, wie beschrieben, da eine Kommerzialisierung, die passiert, wo der Drive für neue Zeitschriften, für neue Journale, eigentlich ein anderer ist, als den man sich in der Forschung vorstellen möchte, nämlich um Wissen zu verbreiten. Da geht es… Historisch gesehen kann man da weit zurückgehen in ein paar Jahrzehnte und kann sich mal die Geschichte von Robert Maxwell anschauen, der das letztlich ja die Grundzüge auch für Elsevier gelegt hat. Es gibt einen fantastischen Artikel im Guardian dazu, den ich jedem empfehlen kann, Longread, der das mal aufdröselt. Und wir befinden uns in einem System, was darauf basiert, auf dieser Entwicklung basiert. Und wenn man jetzt mal Open Access anschaut, was dann in den letzten Jahrzehnten angenommen wurde, hat man natürlich erstmal den Ansatz, okay, die Leute kommen dann an das Wissen ran. Man hat diese Bezahlschranken entfernt. Das ist immer ein Fortschritt, ganz auf jeden Fall. Aber das Problem ist natürlich, dass auch hier die kommerziellen Verlage zu einer Preisspirale… oder in einer Preisspirale sich befinden, die einfach nach oben geht und das ganz klar ausnutzen, dass wir eine sehr starke Verknüpfung an unser Incentive System, an unser Bewertungssystem von Forschenden auch haben. Das heißt also, wenn ich bei großen Verlagen, bei bekannten, nummerierten Zeitschriften publizieren möchte, kann ich da mehr als 10.000 € für Open Access klaglos hinlegen, das heißt also APCs. Das heißt, da ist irgendwas, läuft irgendwas falsch. Und wenn man sich auch die Gewinnmargen anschaut, die weiterhin sehr hoch sind, auch im Open Access. Also teilweise über 40%, da stimmt irgendwas nicht. Und mit diesem Konzept wollen wir dem entgegenwirken. Wir wollen das wieder an die Akademiker zurückführen und damit auch diesen Abschluss vermitteln. Das kann man ganz klar sagen. Also wenn 40% Gewinnmarge irgendwie abfließen, dann fehlt das an Forschungsgeldern an anderer Stelle. Und durch dieses System kann man dem entgegenwirken, kann das Ganze einfangen, kann wieder Kontrolle zurückgeben an die Forschenden und wirklich auch bedarfsgerecht arbeiten. Das war auch ein Problem. Es wurden Journale gegründet, einfach weil es ging, weil es ein unsättigbarer Markt war. Und das hat dem System nicht gutgetan. Und durch diesen Ansatz können wir das einschränken.
[00:09:50] Doreen Siegfried:
Sie schreiben ja in diesem Papier, dass so pro Jahr ungefähr 10 bis 20 Millionen dafür aufgebracht werden sollen vom Wissenschaftssystem. Wo kommen die her? Also wo kommt das Geld her?
[00:10:05] Diethard Tautz:
Ja, diese 10 bis 20 Millionen sind eigentlich nur der Startpunkt. Also das geht darum, einen Versuch zu starten, ob das Ganze überhaupt funktioniert. Tatsächlich ist das Volumen, das nötig wäre, um wissenschaftliches Publizieren auf diese Finanzierungsbasis zu stellen, wesentlich höher. Aber man möchte ja nicht sozusagen maximal starten. Wo kommt das Geld her? De facto zahlen wir ja sehr viel Geld für wissenschaftliches Publizieren, eben über die Gebühren an die Verlage. Auch der DEAL-Prozess sind ja sehr hohe Millionenbeträge im Spiel. In irgendeiner Form müssen wir das umschichten, denn wir sparen das jetzt sozusagen an anderer Stelle wieder ein. Natürlich funktioniert das nicht so eins zu eins, aber man muss mal einen Start machen. Ich sage… Also, wir kennen das Prinzip, ja als Förderung der Forschungsinfrastruktur. Wir haben gerade eine große Diskussion, dass wir größere Dateninfrastrukturen brauchen, Rechenzentren, die auch öffentlich finanziert werden sollen und dann aber allen Wissenschaftlern zugänglich sind. Und zwar auch internationalen Wissenschaftlern. Also, das ist jetzt eine staatliche Aufgabe, die aber eine Gemeinschaftsaufgabe für die Wissenschaft ist. Oder zum Beispiel gerade um die Kieler Landschaft zu beziehen, Forschungsschiffe werden auch als Infrastruktur mit sehr hohen Millionenbeträgen gefördert. Da geht es oft… Der Bau der Schiffe kann gut mal bis zu einer Milliarde kosten und das wird erstmal investiert, um der internationalen Wissenschaft zur Verfügung zu stellen.
[00:11:39] Doreen Siegfried:
Wer investiert das? Also, wo kommt das denn her?
[00:11:41] Diethard Tautz:
Das sind oft Bund-Länder-Zusammenarbeiten. Das muss man dann im Einzelnen sehen. Grundsätzlich für die Finanzierung der öffentlichen Wissenschaften wäre natürlich der Bund zuständig, also das Bundesministerium für Forschung und Technologie, wie es bisher hieß. Ich weiß gar nicht, wie der neue Name ist. Das wäre natürlich auf Dauer der Ansprechpartner. Wir hoffen aber, jetzt für die erste Finanzierung müssen wir erst mal sehen, ob man das aus den laufenden Etats der großen Forschungsorganisationen machen kann, um ein Pilotprojekt zu starten.
[00:12:14] Doreen Siegfried:
Und die großen Forschungsorganisationen wären dann wer?
[00:12:19] Diethard Tautz:
Ja, das wären die, die in der Allianz organisiert sind. Also Leibniz-Institute, Helmholtz Gesellschaft, Max-Planck-Gesellschaft, DFG.
[00:12:26] Doreen Siegfried:
Die Forschungsgemeinschaften. Okay. Und haben Sie auch schon Ideen, wie das dann nachhaltig funktionieren soll? Also, Sie haben gesagt okay, am Anfang muss man mal gucken und die Forschungsgemeinschaften müssen das irgendwie, müssen zusammenlegen. Wie kann das dann tatsächlich eskalieren sozusagen?
[00:12:45] Diethard Tautz:
Wie gesagt, grundsätzlich sehe ich es als Infrastrukturprojekt an. Erstens erwarten wir ja, dass es dadurch billiger wird, die ganze Finanzierung der Publikationen. Insbesondere wenn es eben dann auch im internationalen Maßstab von Kooperationen geht. Generell ist, wie gesagt, dies ein völlig übliches Finanzierungsprinzip, Forschungsinfrastruktur auf Dauer zu finanzieren bzw. auch mit Begutachtung zu finanzieren. Aus irgendeinem erstaunlichen Grund ist nur das wissenschaftliche Publizieren selbst der Kommerzialisierung ausgeliefert worden, während alle andere Forschungsinfrastrukturen selbstverständlich vom Staat getragen werden.
[00:13:27] Doreen Siegfried:
Okay, aber das heißt, das würde heißen, die Forschungseinrichtungen oder der Bund kürzt den Einrichtungen den Etat, der bislang verwendet wurde, tatsächlich für APCs, für was auch immer und nimmt das Geld, um sozusagen diese Art von Finanzierung zu stemmen. Ist das, ist das, was Sie sich vorstellen?
[00:13:48] Diethard Tautz:
Das wäre eine Möglichkeit. Natürlich sind in den Etats die APCs bisher gar nicht explizit ausgewiesen. Also diese finanzielle Bilanzierung müsste man irgendwann machen. Das ist klar.
[00:14:02] Doreen Siegfried:
Okay. Sie haben das ja sicherlich irgendwie auch mal ein bisschen durchgerechnet. Wie setzt sich denn der finanzielle Bedarf für den Betrieb einer typischen Zeitschrift nach diesem Diamond-Open-Access-Modell konkret zusammen? Also was müsste man denn pro Zeitschrift an Geld investieren?
[00:14:22] Diethard Tautz:
Ja, das… Da gibt es sehr, sehr breite Margen. Also das ist ja auch eine Diskussion: Wie hoch sind die APCs? Was sollten Verlage verlangen? Und wir können im Moment im Markt nur beobachten und sehen, dass die Spanne an APCs, die verlangt werden, riesig ist. Eben, manchmal angefangen von vielleicht 500 € pro Artikel, bis zu 10.000 € oder mehr. Und dahinter stehen natürlich zum Teil unterschiedlicher Aufwand, den man dann anschauen muss. Eine Zeitschrift, die sehr viele Publikationen ablehnt, also sehr viel im Hintergrund arbeitet und da Services macht, kostet natürlich mehr als eine, die quasi jedes ihrer Artikel publiziert. Wir würden gegenwärtig nicht sagen können, was es exakt kostet. Man muss, man kann schätzen. Man kann… So eine Größenordnung, die die DFG oft ansetzt, ist etwa 2.000 € pro Artikel, ist für eine anspruchsvolle Zeitschrift adäquat. Die Kosten, die dazukommen sind natürlich, wie wir in unserem Papier sagen, auch das Community Building. Denn es gibt ja … die Qualitätskontrolle soll ja durch Fachgesellschaften stattfinden, die selber eine eigene wissenschaftliche Community bilden. Und dieses Community Building beinhaltet zum Beispiel die Organisation von Konferenzen, Workshops oder Unterstützung von jungen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen. Und das sind Kosten, die obendrauf kommen, quasi als Overhead.
[00:16:00] Konrad Förstner:
Man muss natürlich davon auch ausgehen, dass es Skaleneffekte gibt. Also das heißt, je mehr man auf dieses System setzt, desto günstiger wird auch die einzelne Zeitschrift werden. Und ich würde die Argumentation mal umdrehen. Wir können uns dieses andere System eigentlich nicht leisten. Wir verschwenden, noch mal, wie vorhin gesagt, eigentlich 40% gehen ins Shareholder Value rein, so. Und von daher sind diese 10 bis 20 Millionen, die wir jetzt erstmal initial ansetzen, bzw. auch später die Kosten dafür, sind verhältnismäßig gering dagegen. Wenn wir dieses System etablieren können, werden wir langfristig sparen. Natürlich kommt ja die Frage der Umverteilung, aber eine solche Investition ist eigentlich auch, also 10 bis 20 Millionen sind erstmal marginal. Wenn man in Richtung Infrastruktur denkt, ist das sehr überschaubar und es ist ein Experiment, auf das man sich erstmal einlässt. Und dann muss natürlich das als Kristallisationskern genutzt werden, um entsprechende Verhandlungen zu haben, um das weiter zu optimieren und zu gucken, wo auch die Quellen für weitere nachhaltige Finanzierung dann stattfinden.
[00:17:00] Doreen Siegfried:
Sie hatten eingangs gesagt, Herr Tautz, dass das Neue, das Innovative an Ihrem Vorschlag auch ist, dass die Zeitschriften bezüglich ihrer Infrastrukturqualität, ihrer Services evaluiert werden sollen. Haben Sie da Indikatoren für? Und wer soll das machen? Und was kostet das wieder?
[00:17:21] Diethard Tautz:
Na ja, die Evaluierung würde natürlich von den bekannten Evaluierungsinstitutionen, insbesondere in Deutschland DFG, getragen werden. Könnte auch von anderen… Volkswagen Stiftung macht auch eine sehr, sehr detaillierte Evaluierung. Die Kriterien müssen im Einzelnen fachspezifisch festgelegt werden. Weil man kann da nicht pauschale Kriterien für alle Fächer sich überlegen. Aber als wichtigste Kriterium wird sicher sein: Welche Bedeutung hat die Zeitschrift für die wissenschaftliche Community? Wie stark ist die antragstellende Community, sodass sie tatsächlich hochqualitative Wissenschaft bewerten kann? Und dann kommen natürlich die praktischen Services dazu, die aber wahrscheinlich also, ja… Wie geht man um mit Submissions? Wie geht man um mit Beschwerden oder Integrität der Wissenschaft oder all diese kleinen zusätzlichen Adenda. Aber das Wichtigste ist die wissenschaftliche Qualität. Und den Impact, den man erreichen kann. Und das ist eben die Idee, dass man damit diese Impactfaktoren ablösen kann, die bisher sehr stark die Diskussion um Zeitschriften dominiert haben. Das heißt, man bekommt dann, wenn man so möchte, ein Three-Star-, Two-Star-, One-Star-Rating der Zeitschriften. Und danach können sich dann auch wieder Forschungsorganisationen oder auch Rekrutierungskommissionen richten und sagen, das ist eine sehr hochqualitative Zeitschrift, weil sie durch die Evaluierung so festgestellt wurde.
[00:19:03] Doreen Siegfried:
Okay. Das heißt, es geht doch gar nicht so sehr um den Service. Wie schnell ist das Vor-Screening? Wie schnell kriege ich eine Ablehnung oder eine Zusage oder wie freundlich werden die E-Mails formuliert? Sondern es geht tatsächlich um den Inhalt.
[00:19:17] Diethard Tautz:
Das wird, also dieser Service wird ein Teil sein, aber das Wichtigste wird sicher die wissenschaftliche Qualität sein.
[00:19:23] Doreen Siegfried:
Okay. Wenn wir noch mal über Kosten sprechen. Also, wir hatten jetzt ja gerade schon gesagt, okay, es hängt natürlich an dem Zeitschriftenmachen einiges an Arbeit dran. Also die ganze redaktionelle Arbeit, das, was Sie jetzt schon sagten, die ganzen Submissions irgendwie zu organisieren usw. Soll das dann noch mal gesondert finanziert werden oder ist das schon in diesen round about 2.000 € eingepreist?
[00:19:51] Diethard Tautz:
Das wäre eingepreist. Also, wie gesagt, es gibt einen Etat. Und mit dem Etat können ja Dienstleister beauftragt werden. Oder man kann eben Plattformen, die anderweitig finanziert werden, nutzen. Das muss dann im Einzelnen die antragstellende Institution sagen, wie sie es gerne machen möchten.
[00:20:10] Doreen Siegfried:
Okay. Sie haben jetzt in diesem Papier einen starken Fokus auf den Fachgesellschaften. Warum jetzt ausgerechnet die Fachgesellschaften?
[00:20:18] Diethard Tautz:
Ja, Fachgesellschaften und Akademien sind ja traditionell diejenigen, die die Qualitätssicherung betreiben von Zeitschriften. Auch von kommerziellen Zeitschriften stehen ja im Hintergrund letztlich oft genug entweder Fachgesellschaften oder Wissenschaftler, die in Fachgesellschaften organisiert sind. Insofern ist das jetzt nichts Ungewöhnliches. Das sind diejenigen, die die Qualitätssicherung machen müssen, und da kommen wir auch nicht drumherum. Das Problem bei Fachgesellschaften ist natürlich auch immer, dass die Gefahr besteht, dass ein zu enges Fachdenken entsteht. Das muss man sich klar sein. Andererseits haben wir ja deswegen auch eine Diversität in einer Zeitschriftenlandschaft, gerade auch international, die eben die Option lässt, auch in anderen Zeitschriften zu publizieren. Oder selbst national gibt es manchmal konkurrierende Fachgesellschaften zu dem gleichen Thema.
[00:21:08] Konrad Förstner:
Man muss auch hier wieder historisch sagen: Historisch war das so. Also wir haben ein paar Dekaden gehabt, wo das jetzt anders durch die kommerziellen Verlage übernommen wurde. Aber wenn man weiter zurückschaut… Und auch die Gründung von Journalen ist ja ganz eng mit den Fachgesellschaften verknüpft. Also bewegen wir uns eigentlich hier wieder auf den Ursprung zurück, der viele Jahrhunderte eigentlich funktioniert hat.
[00:21:28] Doreen Siegfried:
Ja, okay. Jetzt muss ich noch mal fragen als, ja, als Laie. Also Wissenschaftler:innen aus den Fachgesellschaften sollen die Zeitschriften, die von ihrer eigenen Fachgesellschaft herausgegeben werden, evaluieren. Also, ich würde ja beispielsweise meine eigene Fachzeitschrift natürlich supergut evaluieren, weil ich habe ja einen unmittelbaren Vorteil davon. Also besteht da nicht die Gefahr, dass diese Fachgesellschaften eine zu dominante Rolle haben?
[00:22:01] Diethard Tautz:
Die Fachgesellschaft evaluiert ja nicht die eigene Zeitschrift, sondern die Einreichungen zu dieser Zeitschrift. Die Zeitschrift selber wird von einem externen Board evaluiert.
[00:22:11] Doreen Siegfried:
Ah, okay. Ja.
[00:22:13] Konrad Förstner:
So wie das auch bei anderen Infrastrukturen gemacht wird. Natürlich hat man da Leute, die aus dem Fach mit dann dazu kommen, aber auch Fachfremde, um diese verschiedenen Perspektiven abzudecken. Das ist hier ganz ähnlich wie bei, sagen wir, bei NFDIs bei FEDs und ähnlichen Infrastrukturprojekten, die wir heute ja sehr, sehr weit auch fördern.
[00:22:30] Doreen Siegfried:
Jetzt gibt es ja auch scholar-led Journals, die nicht von Fachgesellschaften herausgegeben werden. Welche Rolle spielen die in diesem Prozess? Oder besteht hier die Gefahr, dass die so ein bisschen hinten runterrutschen?
[00:22:44] Diethard Tautz:
Na, die können sich ja auch eine rechtliche Organisation… Also, das Wichtige ist, wer einen Antrag stellt, muss ja in irgendeiner Form eine rechtliche Organisationsform haben, um überhaupt öffentliche Mittel bekommen zu können. Man kann ja, man könnte theoretisch natürlich eine neue Gesellschaft nur für den Betrieb des Journals gründen, um das sicherzustellen. Also das ist nur eine Organisationsfrage, aber…
[00:23:05] Doreen Siegfried:
Okay.
[00:23:06] Diethard Tautz:
… wenn eine Gruppe von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zusammenkommt, um ein Fach abzudecken. Gerade bei neu entstehenden Fächern passiert das ja immer öfter, dass sich eine Gruppe zusammenfindet. Und dann denken sie oft auch darüber nach, eine Fachgesellschaft zu dem Thema zu gründen. Eben um eine Organisationsstruktur zu haben, die Mittel verwalten und umsetzen kann.
[00:23:26] Doreen Siegfried:
Sie schreiben auch in Ihrem Paper oder in Ihrem, in diesem Finanzierungspapier, dass der Vorteil von diesem Fokus auf den Fachgesellschaften auch da drin liegt, dass ja sozusagen die Mitglieder der Fachgesellschaften sowieso in den Editorial Boards der renommierten Fachzeitschriften sitzen und von daher sehr gut in der Lage sind, das ganze System zu transformieren. Also, ich kann jetzt für die Wirtschaftswissenschaften sprechen, weil ich mich da gut auskenne. Da ist es so, dass tatsächlich in den Top-5-Journals keine deutschen Wissenschaftler:innen sitzen. Und die Frage, die sich mir stellt: Ist dieses System oder dieser Fokus auf den Fachgesellschaften, ist das nicht gegebenenfalls ein bisschen sehr national gedacht? Oder wo ist da sozusagen noch diese internationale Verbindung?
[00:24:19] Diethard Tautz:
Ja, die internationale Verbindung wird natürlich ein Knackpunkt sein. Also, man möchte… Wissenschaftliche Zeitschriften sollen ja eigentlich international geführt werden, auch wenn sie national finanziert werden sollten. In den Boards soll natürlich eine gute Diversität quer durch, ja quer durch die Spezialdisziplinen, aber auch quer durch die ganze Welt sitzen. Das passiert auch in vielen Journalen, auch jetzigen, schon, die von Fachgesellschaften geführt werden, dass eben auf solche Diversität geachtet wird. Wenn Sie jetzt das Beispiel der Wirtschaftswissenschaften ansprechen, ich glaube, da gibt es natürlich von vornherein, soweit mir bekannt, einen sehr starken Bias nach Nordamerika. Aber das könnte man zum Beispiel durchbrechen durch eine national finanzierte Zeitschrift von der…, wo eben eine andere Gruppe sich findet und sagt, wir machen jetzt eine Konkurrenzzeitschrift auf, lassen uns begutachten und stellen dann damit auch ein Qualitätsprodukt her.
[00:25:23] Doreen Siegfried:
Ja, okay. Also, ich glaube, wir müssen auch noch mal über Anreizsysteme sprechen. Konrad, Du hast es ja am Anfang auch schon thematsiert. Also wie gesagt, also in den Wirtschaftswissenschaften ist der Fokus auf den Top-5-Journals. Und wenn da irgendjemand kommt und sagt: „Ich gründe eine neue Zeitschrift“, es ist, es spielt keine Rolle. Also, die Leute müssen, um sozusagen, ihre Karriere zu organisieren, strategisch publizieren, und zwar in den großen Fachzeitschriften. Daher frage ich mich so ein bisschen, wie man das schafft, das System von innen zu revolutionieren?
[00:25:59] Konrad Förstner:
Ja, das ist natürlich immer der Knackpunkt, dass wir ein gewisses Branding haben, was existiert und wo man natürlich auch einfache Mechanismen und bekannte Mechanismen hat, Leute zu bewerten, die sich auf Stellen bewerben. Aber genau das wäre jetzt hier auch der Ansatz zu sagen, man nimmt Editorial Boards und versucht sie entsprechend zu erzeugen und zu wechseln. Dass man weiß, das sind Vertreter:innen der Community, die das mit bewerten, die auch in dieser Community natürlich auch eine Bewertung von Personen vornehmen in gewisser Weise oder zumindest von Leuten, die das machen, vertraut werden. Natürlich, man muss irgendwo anfangen und auch das wird Zeit kosten. Das ist ein Kulturwandel. Und genau das muss man irgendwann angehen und nicht die Hände in den Schoß legen und sagen, es ist jetzt einfach so, sondern das entsprechend forcieren. Wir haben ja auch… Es gibt ja auch Beispiele, wo wirklich auch Journale geflippt wurden, wo das komplette Editorial Board gewechselt ist und man weiß, okay, dieses Journal war das vorher, war ein kommerzielles Journal vorher und ist jetzt ein Open-Access-Journal geworden. Und das hat dann auch ein entsprechendes Renommee. Und ich weiß, dass ist nicht in allen Gebieten machbar oder so einfach machbar. Aber wir müssen das versuchen. Wir müssen das auch sukzessiv angehen. Das wird auch kein Nenner-Switch bei einigen Gebieten sein.
[00:27:09] Doreen Siegfried:
Ne.
[00:27:11] Konrad Förstner:
Bin ich sehr, sehr sicher. Bei anderen wird es vielleicht einfacher sein. Vielleicht die kleiner, kompakter sind als bei größeren. Aber wir werden auf jeden Fall diese Aufgabe haben, dieses Branding zu ändern. Und genau das wäre auch der Ansatz, das zu explorieren und auch zu gucken, wie man das fördern kann. Wir sehen natürlich aber auch hier die Möglichkeit, wir haben auch Initiativen wie CoARA und ähnliche Sachen, die auch natürlich darauf hinaus gehen, diese Markenmacht, dann ein bisschen zu brechen. Das Gemeinschaftliche das zählt dann auch mit in diese Sachen mit rein, dass wir versuchen, hier einen anderen Kurs einzuschlagen. Und ja, das ist ein Kulturwandel muss man sagen, der nicht von heute auf morgen passiert.
[00:27:47] Doreen Siegfried:
Ja, ja. Also, dass ein Wandel her muss, das ist ja sozusagen steht außer Frage, dass das System, so wie es jetzt läuft, wirklich einige Haken hat. Ich glaube, da, das ist, glaube ich, allen klar. Mich würde aber noch mal interessieren…
[00:28:01] Diethard Tautz:
Ob ich mal kurz zum Branding noch was sagen kann, weil wir haben uns ja im Diskussionspapier explizit zu dem Branding Stellung genommen. Das ist natürlich ganz entscheidend. Dass, ein neues Journal muss von vornherein eine Reputation haben, um Startchancen zu haben. Die Reputation kann durch das Editorial Board kommen, aber auch zusätzlich durch ein Branding des Journal Titels. Wir haben ja vorgeschlagen, dass man solche Journals, die so finanziert werden, zum Beispiel generell als Community Journals bezeichnet. Und denen zum Beispiel ein CJ vorne dranhängt, so dass sie sofort sichtbar sind als ein Instrument, in dem ein begutachtendes Editorial Board ein Qualitätsprodukt liefert. Und dann denke ich, wird auch für viele Wissenschaftler der Umstieg nicht so schwierig sein, weil das auch von den Forschungsorganisationen und Rekrutierungskommissionen anerkannt wird. Und dann können wir den Wandel wahrscheinlich schaffen.
[00:28:59] Doreen Siegfried:
Ja, ich glaube, das muss man immer zusammendenken, dass letztlich in den Berufungsgesprächen usw. da auch ein Fokus drauf ist, dass Leute in solchen Journals publiziert haben. Ja, okay. Aber nochmal, um das Papier von Ihnen zu verstehen, habe ich noch ein paar Fragen. Also, Sie haben im Anhang eine Liste der vorrangig in Frage kommenden Society Journals erstellt, mit denen man erst mal so anfangen kann. Sie haben gesagt, dass so ein Experiment sein, wir starten erstmal. Das sind, ich habe es mal durchgezählt, 62 Journals. Jetzt haben Sie geschrieben, damit die gefördert werden können überhaupt, müssen sie in ihrem Fach, im oberen Drittel irgendwie im Ranking angesiedelt sein. Das heißt, die Zahl reduziert sich dann noch mal. Wie kann das Thema skalieren? Also, oder ist man dann schon nach einem Jahr fertig, wenn das sich am Ende nur so um 20, 25 Journals handelt?
[00:30:01] Diethard Tautz:
Ja, das ist eben der Charakter des Pilotexperiments, auf welche Journals möchte man sich konzentrieren? Wir haben eben herausgeschrieben, dass es erst mal eine Konzentration ist auf die Zeitschriften, die bereits eine gute Sichtbarkeit haben. Genau eben, um dieses Problem ein bisschen zu umgehen, dass sie nicht akzeptiert werden können von der Community. Das ist also… Für die Frühphase ist gedacht, auf diese schon bereits gut etablierten ─ das sind, die Liste besteht aus Journals, die von Fachgesellschaften bereits publiziert werden und Open-Access-Verfahren haben, in der Regel aber über APC und über einen Verlag getragen. Und das wäre sozusagen das Target für das Pilotprojekt. Wie sich das Ganze dann weiterentwickelt, das muss man eben dann sehen.
[00:30:47] Doreen Siegfried:
Okay, was mich noch interessieren würde: Also mal angenommen, es gibt jetzt 20 Millionen Euro. Man sagt, „Okay, wir starten jetzt das Pilotprojekt und alle dürfen jetzt, alle Fachgesellschaften dürfen jetzt ihre Anträge stellen.“ Dann tritt ja die Chemie gegen die Wirtschaftsforschung an, gegen die Mathematik, gegen die Medizin. Also ganz unterschiedliche Fächer mit ganz unterschiedlichen Hintergründen kommen in einen Wettbewerb. Wer entscheidet, welches Fachjournal zuerst gefördert wird? Also, wie soll das funktionieren?
[00:31:22] Diethard Tautz:
Ja, da sprechen Sie eine interessante Frage an. Ich habe eher das gegenteilige Problem, dass ich nicht genügend, am Anfang nicht genügend Fachgesellschaften finden könnte, die das machen möchten.
[00:31:32] Doreen Siegfried:
Ach so? Okay.
[00:31:33] Diethard Tautz:
Aber natürlich wollen wir diesen Wettbewerb ja auch. Und ich denke, dass die Fächer gegeneinander antreten… Gut, das muss man sehen, ob das unterschiedliche Bewertungspanels dann machen und für jedes Großfach ein eigenes Budget existiert, das müsste noch entschieden werden, denke ich. Aber im Moment geht es ja darum ─ und da würde ich auch alle Fächer gegeneinander antreten lassen ─ erstmal zu zeigen, dass das Prinzip funktionieren kann. Und da könnte es sein ─ Sie haben die Chemie angesprochen, die ja in Deutschland besonders dominant ist, mit gut etablierten Journals, die von der Fachgesellschaft herausgegeben werden ─ könnte natürlich ein bisschen abräumen gegenüber anderen Journals. Aber das müsste dann später wahrscheinlich nachgesteuert werden, so dass jeder eine Chance hat.
[00:32:31] Doreen Siegfried:
Und wer würde…
[00:32:31] Konrad Förstner:
…dass man die Initialisierungsphase erst mal nutzt, um das auch zu zeigen, dass es funktioniert, ist das ja auch gut, das ja auch erstmal zu fokussieren. Also der Anspruch, jetzt irgendwie das komplette deutsche oder internationale System da drauf zu mappen, das ist, das existiert nicht. Es geht darum, das auszutesten, vielleicht auch daraus zu lernen und dann in weiteren Runden das zu verfeinern und zu verbessern.
[00:32:50] Doreen Siegfried:
Ja, okay. Dann noch mal genau zum Prozess. Also, wer würde in dieser disziplinübergreifenden Evaluierungsgruppe sitzen, um zu sagen, „Okay, ich habe jetzt hier 20 Anträge liegen.“ Ich müsste ja sozusagen … Diese Gruppe müsste sich ja irgendwie austauschen und sagen, „Okay, diese Fachzeitschrift scheint mir doch ein bisschen wertvoller zu sein, einen höheren Impact zu haben als die.“ Also wie soll das laufen? Und die zweite Frage, die sich auch so um den konkreten Prozess tummelt, ist die Frage: Wie wird dann dieser Übergang organisiert werden von einem klassischen, von einer klassischen Subskriptionszeitschrift hin zu einer schrittweisen Umstellung zu einem Diamond-Open-Access-Modell? Also es sind zwei Fragen. Vielleicht erstmal die erste Frage.
[00:33:37] Diethard Tautz:
Also das ist natürlich … Dafür brauchen wir eine Forschungsorganisation, die weiß, wie man Begutachtungen durchführen kann, auch über verschiedene Disziplinen. Und das ist… Deswegen wird es wahrscheinlich eine Aufgabe der DFG werden, die ja auch die ganzen Exzellenzinitiativen, wo ja auch diverse Fächerkulturen zusammenkommen, gemeinsam begutachtet. Also, das ist ein ganz großer Challenge, aber dafür haben wir sehr gut etablierte Strukturen, da habe ich jetzt keine Sorge. Umstieg ist ja nicht langsam, sondern für eine gegebene Zeitschrift ist es sofort anders. Also von eben einem Bezahlmodell zu eben Diamond Open Access. Das muss man … Für eine gegebene Zeitschrift ist es ja kein langsamer Prozess. Aber natürlich für die Summe der Zeitschriften würde das nur Schritt für Schritt passieren können.
[00:34:28] Doreen Siegfried:
Ja, okay. Also ich weiß es aus unserem Kontext bei OLEcon, dass es ja doch auch beratungsintensiv ist diese Umstellung, wenn es nachher um das konkrete praktische Doing geht. Also, wer würde denn diese Begleitung machen?
[00:34:43] Diethard Tautz:
Also, da habe ich wenig Sorge. Was die Fachgesellschaften gerade mit erfolgreichen Zeitschriften ohnehin machen ist, immer wieder sich um zu gucken, ob sie unterschiedliche Verlage finden, die bessere Angebote machen können. Das ist für die sowieso schon eine Standardprozedur. Und wie gesagt, die Details der Umsetzung kann man ja durchaus erfahrenen Verlagen überlassen. Nur das es in irgendeiner Form ein Ausschreibungsmodell dafür geben muss. Damit die Verlage dann eben nach wie vor Profite machen dürfen. Aber nicht mehr diese überproportionalen Profite.
[00:35:17] Doreen Siegfried:
Ja, okay. Das heißt, die müssen… Man macht ganz klassisch einen Beschaffungsantrag, wie es der öffentliche Dienst so liebt und sagt, „Okay, wir brauchen jetzt einen Dienstleister, einen Verlag, der uns das und das und das macht“ und dann kriegt den Zuschlag der Verlag, der den besten Preis anbietet.
[00:35:32] Diethard Tautz:
Das ist so, wie wir das handhaben.
[00:35:34] Doreen Siegfried:
Ja.
[00:35:34] Diethard Tautz:
Auch wenn es ungeliebt ist. Aber es ist tatsächlich das Beste, was wir bisher machen.
[00:35:39] Doreen Siegfried:
Ja, okay.
[00:35:40] Konrad Förstner:
Und was sich auch an allen Stellen sehr gut bewährt hat. Von daher… Also es ist, man muss sich immer wieder vor Augen halten, also wir sind in dieses System geschmissen und nehmen das als einfach so hingegeben, als gegeben hin. Und es ist erstaunlich, wenn man einfach die Historie mal aufkrempelt und schaut, wie wir hingekommen sind. Es ist sehr seltsam, dass wir uns jetzt in dieser Situation befinden und das jetzt zurückrollen müssen und dass das eine Ausnahme war. Von daher ist es tatsächlich… Es sind ganz normale Verfahren, die dann hier angewandt werden in einem System innerhalb vom Wissenschaftssystem. Von daher eigentlich gar nichts Besonderes.
[00:36:07] Doreen Siegfried:
Ja, ja, okay. Sie schreiben ja auch in Ihrem Papier, dass bei dieser ganzen Finanzierung ─ und Wissenschaft ist nun mal international ─ dass Sie sich da auch so eine internationale Co-Finanzierung vorstellen können. Also wie genau stellen Sie sich das vor? Wie kann das aussehen?
[00:36:22] Diethard Tautz:
Ja, grundsätzlich geht es da nur um eine rechtliche Organisationsform. Also es gibt ja schon Beispiele für Co-Finanzierungen. Berühmtestes Beispiel ist die Zeitschrift eLife, die eben von verschiedenen Forschungsorganisationen gegründet wurde als Diamond Open Access, allerdings jetzt auch gezwungen ist, wieder APCs zu kassieren. Was eine sehr interessante Entwicklung ist, weil eigentlich wie gesagt, scheinbar ist das wissenschaftliche Publizieren das einzige, das einem Kommerzialisierungsdruck unterlegt wird. Alle andere wissenschaftliche Infrastruktur hat dieses Problem eigentlich nicht. Das wäre so ungefähr, als wenn man, wenn man Rechenzentren zwingen würde, Gewinne zu erzielen. Das ist eben gerade nur beim Publizieren, hat sich so eingeführt. Generell können unterschiedliche Organisationen… Es geht ja nur um die Rechtsform, in der man das Geld verwalten kann. Das muss gefunden werden. Aber dann können natürlich alle ihre Beiträge leisten. Und das könnte natürlich auf europäischer Ebene ganz besonders gut funktionieren, weil da ja schon die Mechanismen alle gut etabliert sind, wie man öffentliche Gelder ausgeben kann in einem gemeinsamen Kontext.
[00:37:31] Doreen Siegfried:
Ja, okay. Nochmal zum Thema Nachhaltigkeit, Langfristigkeit. Also, wie haben Sie sich das vorgestellt oder was ist vorgesehen an Maßnahmen, um letztlich eine langfristige finanzielle Stabilität zu erreichen, aber auch eine gewisse Widerstandsfähigkeit gegenüber wirtschaftlichen oder auch politischen Veränderungen, die ja auch ständig passieren können? Gerade vor dem Hintergrund einer im Fokus nationalen Förderung bei einer gleichzeitig internationalen Autorenschaft. Also, wie fragil oder wie stabil ist das? Wo sehen Sie da Herausforderungen gegebenenfalls?
[00:38:18] Diethard Tautz:
Na ja, nochmal zur Erinnerung: Wie wir Forschung finanzieren, ist ja genau nach diesem Prinzip: also, wir vergeben Grants an, nationale Grants, an Forscher, die eben im nationalen Kontext gestellt werden. Die Forschungsergebnisse, die dabei rauskommen, sollen aber öffentlich im Open-Access-Prinzip publiziert werden, das heißt, stehen der gesamten Welt zur Verfügung. Das heißt, der Betrieb einer wissenschaftlichen Zeitschrift ist nichts anderes als genau das. Jemand macht eine Finanzierung und erlaubt damit sozusagen einer Community der Wissenschaft, einer weltweiten Community der Wissenschaftler, daran zu partizipieren, weil man sich damit, in gewisser Weise, Standortvorteile erkauft. Dieses ganze System steht immer unter einem gewissen Finanzierungsvorbehalt. Das wäre jetzt für Zeitschriften sollte es eigentlich nicht anders sein. Wir müssen das einfach aus dem Kopf rauskriegen, dass Zeitschriften was Besonderes sind im Wissenschaftssystem. Es soll so finanziert werden, wie das gesamte Wissenschaftssystem. Und wenn man tatsächlich zu finanziellem Druck kommt, dann ist eben das gesamte Wissenschaftssystem unter Druck und nicht nur eine bestimmte Komponente.
[00:39:31] Konrad Förstner:
Man muss einfach den Sweet Spot finden, zwischen nachhaltig und damit Sicherheit, aber natürlich auch Dynamik und Anpassungsfähigkeit. Und diese fünf bis sieben Jahre, die sich auch bei Leibniz-Instituten oder anderen Institutionen ja auch durchgesetzt hat, ist wahrscheinlich ein ganz guter Zeitrahmen, wo man sagen kann, okay, wir können hier … Für diesen Zeitrahmen wissen wir, dass wir da sind, dass wir laufen. Die Community weiß das. Aber gleichzeitig ist auch ein Qualitätsanspruch gegeben, der sich auch bewähren muss und der auch belegt werden muss, um dann weiter gefördert zu werden. Und da hat man eigentlich eine ganz gute Balance zwischen diesen beiden Werten, die man eigentlich haben möchte.
[00:40:06] Doreen Siegfried:
Ja, okay. Also, jetzt noch mal sozusagen… Also, ich kann das total verstehen und ich finde das auch gut. Aber jetzt noch mal sozusagen mit der Brille, vielleicht auch aus Sicht eines Verlages argumentiert. Also, die bestehenden Subskriptionszeitschriften, beispielsweise in den Wirtschaftswissenschaften, die würden alle von sich behaupten, wir sind High Quality. Also, was die Qualität unserer Artikel betrifft, besteht da 0,0 Frage, dass das irgendwie keine super tippitoppi Forschung ist, mit der jede Person, die bei uns veröffentlicht, das goldene Ticket für den nächsten guten Job hat. Also, das heißt, wenn da eine Evaluierung nur mit einer inhaltlichen, nur mit einem inhaltlichen Fokus passiert, dann frage ich mich, vielleicht ist es auch naiv gefragt, aber ich frage es trotzdem jetzt hier mal. Dann frage ich mich, wann man, an welcher Stelle man da sagen würde: „Stopp. Das funktioniert jetzt irgendwie nicht mehr.“ Verstehen Sie, was ich meine?
[00:41:06] Konrad Förstner:
Na gut, man muss natürlich sagen, es gibt ein… Es gibt ja, es wurde vielleicht eine Handvoll von Top Journalen genannt, die wahrscheinlich diese Hürde sehr leicht nehmen. Aber es gibt ja tausende von kleinen Journalen, die auch aus fraglichen Gründen gegründet wurden, und die würden damit wahrscheinlich wegfallen. Aber das… Beziehungsweise man hätte hier ein Ranking der verschiedenen Journalklassen. Und ich glaube, das würde auch diesen Markt einfach bereinigen und würde auch dafür allein durch dieses Branding mit dem Community Journal dafür sorgen, „Okay, ich weiß, das ist etwas, was qualitätsgeprüft ist, vielleicht auch gewisse Einstufungen besitzt. Und da bewege ich mich rein.“ Dann fallen auch viele Sachen weg, viele Journale weg, die aus einem anderen Grund gegründet wurden, als Wissensverbreitung.
[00:41:49] Doreen Siegfried:
Ja, ja, okay. Jetzt haben Sie ja viele Ideen skizziert. Sehen Sie auch irgendwo Schwierigkeiten oder potenzielle Risiken in diesem ganzen System, wo Sie sagen würden, „Also, da müssen wir ein besonderes Augenmerk draufhaben, dass genau das jetzt irgendwie nicht passiert oder dass man dafür gleich irgendwie so einen doppelten Boden einsetzt“?
[00:42:11] Diethard Tautz:
Na ja, es ist ein neues System, das sicher eine ganze Weile dauert, bis es flächendeckend umgesetzt werden kann. Wenn wir schon allein an die Open-Access-Transformation denken, die jetzt schätzungsweise seit 40 Jahren schon läuft und immer noch nicht umgesetzt ist, obwohl eigentlich die Wissenschaft durchgehend der Meinung ist, das sollte man so haben, wird es ein langsamer Prozess sein. Und da werden natürlich auch Knackpunkte kommen. Und wir hatten eingangs schon angesprochen, dass eine bestimmte Fachgesellschaft ihr Fach zu sehr dominieren kann. Da müsste man sicher vorbauen, dass Konkurrenz möglich ist, auch im Denken Konkurrenz möglich ist und damit konkurrierende Journals möglich sein müssen. Das wird sicher eine Frage sein. Das könnte sich lösen durch einen internationalen Maßstab, da eben internationale Begutachtungskommissionen in unterschiedlichen Ländern bestimmte Journals favorisieren werden. Aber das ist ein Problem, das auftreten könnte. Die andere Frage ist, die mich im Moment ehrlich gesagt ein bisschen mehr umtreibt, ob die Fachgesellschaften mitziehen. Denn das ist natürlich, sie haben ein sehr weiches Bett im Moment. Wenn Verlage ihnen alles abnehmen. Und dann sagen sie, na ja, dann sollen sie halt ihre 40% Revenues machen und wir haben nicht viel Arbeit mit diesem Journal. Wobei man natürlich ein bisschen unterschätzt, dass die Arbeit ja eigentlich die Qualitätskontrolle ist. Und die liefert man bisher eigentlich umsonst an die kommerzielle Verwertung ab. Und da muss ein Umdenken passieren, auch auf Seiten der Wissenschaft. Dass man das sozusagen für sich selber arbeitet und eben nicht für die Revenues von irgendwelchen Investoren.
[00:43:53] Doreen Siegfried:
Ja, okay. Jetzt hatten Sie ja eingangs gesagt, also mal angenommen, die Fachgesellschaften schreiben jetzt alle ihre Anträge, dann gibt es eine Evaluierungskommission, die muss sich noch über Kriterien verständigen, nach denen die dann bewertet werden. Haben Sie sich denn schon Kriterien überlegt für eine Re-Evaluierung? Also Konrad, du hattest gerade gesagt, Institute der Leibniz-Gemeinschaft alle sieben Jahre, gibt es einen Kriterienkatalog, dann wird man evaluiert. Geldhahn auf, Geldhahn zu oder wie auch immer, welche Auflagen es gibt. Gibt es da schon irgendwas in Ihrer Schublade, wo Sie sagen, „Okay, das sind die Kriterien, die wir tatsächlich heranführen, um die Fortsetzung mit diesem neuen Finanzierungsmodell zu steuern“?
[00:44:40] Konrad Förstner:
Also, das haben wir in seiner Tiefe noch nicht ausgearbeitet. Aber das sind natürlich Sachen, die sich auch an Infrastruktur orientieren. Wir hatten das ja vorhin schon angesprochen, dass inhaltliche Qualität, aber auch solche Service-Qualitätskriterien können da sicher mit einfließen. Das kann beim Start natürlich nicht alles in Gänze evaluiert werden, aber nach laufendem Betrieb, nach ein paar Jahren ist das dann offensichtlich. Auch wie E-Mails beantwortet werden, wie freundlich die Leute vielleicht waren. Und das ist denke ich auch eine Möglichkeit, dass sich die Community dort einbringt und definiert, was sie eigentlich haben möchte. Das heißt, über die Fachgesellschaften können Forschende ja auch sagen, was sie möchten und das entsprechend hier nutzen. Und dann kann man da vielleicht auch einen generellen Fragenkatalog machen. Das mag für unterschiedliche Fachgesellschaften oder Disziplinen auch unterschiedlich sein, aber wahrscheinlich gibt es so ein Kanon an Kriterien, der sich herauskristallisiert und der dann noch erweitert wird durch fachspezifische Kriterien.
[00:45:31] Doreen Siegfried:
Ja, okay, Vielleicht noch eine Frage. Sie haben ja gesagt, „Okay, wenn wir schon revolutionieren, dann auch richtig.“ Dann reden wir auch mal über die Honorierung von Review Tätigkeiten. Also bislang war das, wurde es ja immer mit Reputation und Ehre und einem warmen Händedruck abgegolten. Also, Leute können sagen, „Ich bin Reviewer für das sowieso Journal“ und dann hieß es, super toll oder kann man in seinen CV schreiben. Wenn das jetzt entlohnt werden soll, welches Preisschild würden Sie daran hängen? Was wäre eine gute Entlohnung?
[00:46:09] Diethard Tautz:
Also, da muss man unterscheiden. Die Entlohnung, sagen wir für die Editoren, für die Editorial Board, also die, die sozusagen die harte Arbeit machen. Die Reviewer Entlohnung würde ich in der Tat eher auf dem Reputationssystem sehen.
[00:46:23] Doreen Siegfried:
Okay.
[00:46:24] Diethard Tautz:
Und zwar einem formalisierten Reputationssystem, viel besser als es bisher gemacht wird. Bisher können die Leute zwar irgendwas in die CVs schreiben, aber sie können es nicht nachweisen, dass sie es gemacht haben. Und dafür müssten bessere Infrastrukturen installiert werden, so dass eine nachweisbare Leistung dahinter steht. Und dann muss es auch keine finanzielle Leistung an die Reviewer sein, sondern das wäre dann tatsächlich ein Reputationseffekt, den man sich durch diese Review Tätigkeit erkaufen kann, sozusagen.
[00:46:56] Doreen Siegfried:
Okay, aber das Editorial Board soll schon dafür bezahlt werden?
[00:47:00] Diethard Tautz:
Editorial Board sollte definitiv in irgendeiner Form… Ist inzwischen auch üblich an vielen Stellen. Auch Gutachter werden ja oft bezahlt. Heutzutage ist es nur die DFG, die sich davor zurückscheut, bisher. Aber die meisten Forschungsorganisationen bezahlen Gutachter, aber meistens nur nominell. Also es ist eigentlich nicht, dass jemand damit reich werden kann. Soll ja auch nicht. Man soll ja auch nicht professioneller Gutachter werden. Da muss eine Balance gefunden werden. Ich favorisiere ja immer noch ein Modell, wo man sagt, die Bezahlung einer Editorial-Tätigkeit geht nicht an die Person, sondern an die Institution, an der diese Person arbeitet, eben um die Arbeitszeit zu kompensieren. Und das wäre eigentlich die beste Möglichkeit, ist aber auch steuertechnisch und sonst wie komplizierteste umzusetzende Möglichkeit. Deswegen hat es sich doch eingespielt, dass die Editorial-Tätigkeit direkt honoriert wird, oft. Und dann persönlich versteuert wird und dann fragt niemand mehr nach. Aber da müssen sicher noch Lösungen gefunden werden. Generell gilt das Prinzip, wenn man es nicht honoriert, dann ist es eine freie Ressource, eine Public Ressource und die wird eben überausgenutzt. Und das sehen wir gegenwärtig auch in der sogenannten Reviewer Fatigue passiert das gegenwärtig.
[00:48:23] Doreen Siegfried:
Ja, ja. Vielleicht noch eine Frage, die mir gerade durch den Kopf geht. Sie hatten ja jetzt gesagt, „Okay, wir stellen das ganze Publikationssystem auf andere Füße.“ Jetzt könnte man ja auf der einen Seite sich das so überlegen: Okay, die Leute, die in der Forschung tätig sind, so wie Sie, die machen das jetzt einfach auch noch. Die haben ja sowieso den ganzen Tag noch ein bisschen Zeit, die können das noch mitmachen. Eine andere Möglichkeit wäre ja, zu sagen: Okay, dieses ganze Administrative und Beschaffungsanträge stellen und hier noch mal verhandeln, da noch mal hinterhertelefonieren, da noch mal Formulare ausfüllen, damit irgendwelche Leute irgendwelche Honorare kriegen usw. könnte ja auch ein komplett neues Jobprofil sein. Also, wie stellen Sie sich das idealerweise vor, dass die Wissenschaftler:innen selbst jetzt nicht noch mehr Zeit investieren müssen für Administration, als sie eh schon müssen?
[00:49:20] Diethard Tautz:
Ja, das ist richtig. Die Administration sollte eigentlich als Serviceaufgabe vergeben werden können. Entweder als Teil des Angebotspackages von einem Verlag oder eben auch in einer Person, die beim großen Volumen vielleicht dafür extra eingestellt werden kann. Das heißt, die Wissenschaftler sollen nach wie vor das machen, was sie bisher schon immer machen. Die Bewertung der Einreichungen und die Organisation des Reviewprozesses. Also Organisation in dem Sinne, die Reviewer zu identifizieren und die Review-Qualität abzuschätzen. Aber das Dahinter ist in der Tat eine Serviceleistung, die in irgendeiner Form mitfinanziert werden müsste.
[00:49:58] Doreen Siegfried:
Und würden Sie es präferieren, wenn Sie sagen, „Okay, wir geben das nach draußen, haben wir weniger Arbeit. Das wird irgendwie, die kriegen ihr Geld und dann soll das irgendein Verlag machen“? Oder würden Sie präferieren und sagen, „Also Wissenschaft für die Wissenschaft“, dass es eine Person ist, die dann tatsächlich im Institut tätig ist mit als Zeitschriftenmanager:in oder so was. Also, was würden Sie präferieren?
[00:50:24] Diethard Tautz:
Ich glaube, da würde man keine Vorgaben machen wollen. Das müssen dann die Antragsteller selber sehen, wie sie das leisten können. Das Problem ist ja immer bei der Festanstellung einer Person, man muss ja dann garantieren, dass sie es potenziell zumindest bis zu ihrer Pensionierung oder in Ruhestand gehen finanziert ist. Und das kann man natürlich in so einem System eigentlich gar nicht machen, da sie potenziell nach sieben Jahren wieder wegfallen kann. Also diese Probleme sind ja… müssten gelöst werden. Aber wenn eine Institution das machen kann und denkt… dann müssen sie auch den entsprechenden Vorschlag machen. Also, da sehe ich jetzt keine besondere Präferenz.
[00:51:02] Konrad Förstner:
Genau. Und das geht ja von bis. Das kann sein, dass es in einer eigenen Institution angestellt ist, das kann sein, dass das kommerziell abgebildet wird. Das kann aber auch sein, dass es öffentliche Infrastruktur ist, die das auch wieder zentral abbildet und damit auch natürlich eine gewisse Stabilität, aber auch gleichzeitig Flexibilität für die andere Institution darstellt. Also das ist ein breites Spektrum an Lösungen, die bei so einer Implementierung da vonstattengehen kann.
[00:51:23] Doreen Siegfried:
Ja, okay, super. Vielleicht letzte Frage, auch so ein bisschen in die Zukunft geblickt. Was wäre denn aus Ihrer Sicht so der nächste ganz konkrete Schritt, um aus diesem Papier, was viele Ideen enthält, jetzt tatsächlich ein breitenwirksames Modell zu machen. Also, wie kriegt man das, was Sie jetzt vorhaben, auf die Straße?
[00:51:50] Diethard Tautz:
Ja, als erstes müsste man die Fachgesellschaften davon überzeugen, dass sie das überhaupt machen wollen. Und dafür werden wir in der Tat in der Kürze ein Symposium veranstalten, wo wir Fachgesellschaften aus allen Disziplinen eingeladen haben, um darüber zu diskutieren. Was ist eigentlich die Bereitschaft, sich so einem Modell anzuschließen? Wenn diese Bereitschaft signalisiert wird, dann ist der nächste Schritt in der Tat, die das Geld einsammeln, was wie gesagt, im Moment realistischerweise nur von den existierenden Budgets der Allianzorganisationen passieren könnte. Und dann eben das Pilotmodell. Und wie es danach weitergeht, ist wirklich schwer zu sagen. Also, wir haben hier einen riesigen Umbruch im gesamten Publikationswesen insgesamt. Das haben wir im Moment auch noch gar nicht angesprochen. Das wäre ja, wenn wir nicht mehr von der Bezahlung über einzelne Artikel abhängig sind, sondern ein Gesamtbudget haben, dann ergibt sich auch ein riesiger neuer Spielraum, wie man Publikationsformen neu organisieren könnte. Und da wird es mit Sicherheit einen Umbruch geben. Das ist ja auch ein weiteres Thema unserer eigenen AG, welche Umbrüche da eigentlich anstehen. Und wenn man eine solide Finanzierung hat, dann können auch diese Umbrüche leichter passieren und wie dann das gesamte Publikationswesen in 20 Jahren aussieht, das will im Moment, glaube ich, niemand vorhersagen.
[00:53:12] Doreen Siegfried:
Ja, ok.
[00:53:13] Konrad Förstner:
Und wir haben jetzt natürlich momentan die DEAL-Verträge am Laufen, die natürlich aber auch irgendwann auslaufen und das sind natürlich vielleicht genau solche Bruchstellen, wo man sich überlegen kann, wie wollen wir dieses Geld jetzt einsetzen? Und da arbeiten wir jetzt natürlich schon darauf zu. Versuchen durch dieses, durch diese Arbeit in der AG, diese Ideen zu bündeln, das zu sammeln und natürlich jetzt auch auf dieser Veranstaltung dann entsprechend das weit zu verbreiten, um Leuten einfach vielleicht eine gemeinsame Basis für Diskussionen zu geben. Um dann, wenn die Entscheidungen wieder anstehen, vielleicht auch den Hebel in eine andere Richtung zu legen und zu gucken, wie das vielleicht aussehen könnte.
[00:53:47] Doreen Siegfried:
Okay. Also das heißt, ich fasse noch mal zusammen: Sie machen jetzt demnächst ein Symposium mit allen Fachgesellschaften, laden die ein. Die Fachgesellschaften rufen im Idealfall „Hurra, wir finden das toll!“ Und dann gehen Sie zu
Frau Bär und sagen, „Ich habe da eine Idee, ich brauche 20 Millionen.“
[00:54:06] Doreen Siegfried:
[lacht]
[00:54:08] Diethard Tautz:
So ungefähr funktioniert das, genau.
[00:54:08] Doreen Siegfried:
So ungefähr funktioniert das.
[00:54:10] Diethard Tautz:
Und zwei Wochen später hat man das Geld. Ja.
[00:54:12] Doreen Siegfried:
Ist schon ein bisschen ernsthaft gefragt. Also das heißt, Sie sind der Treiber, jetzt als AG, das Ganze tatsächlich auch umzusetzen?
[00:54:21] Diethard Tautz:
Ja. Na ja. Einzelne können das nie umsetzen. Das muss eine Gesamtüberzeugung passieren. Es muss natürlich auch innerhalb der Organisation, also Max Planck, wo ich ein bisschen was machen kann, aber es müsste dann eben auch auf der Leibniz-Seite auch auf Helmholtz-Seite Ansprechpartner gefunden werden. Dafür gibt es ja auch tatsächlich andere AGs. Es gibt eine Allianz AG zum Publizieren, auch zur Finanzierung oder zur Folge der DEAL-Verträge, die schon Ansprechpartner sind, die dann sozusagen in ihren Organisationen die Lobbyarbeit machen müssen, um das weiterzutragen.
[00:54:54] Doreen Siegfried:
Okay. Aber also noch mal gefragt: Ihre AG hat jetzt die Fackel in der Hand und sagt, „Ich habe eine Idee und Du redest jetzt mit dem, Du redest jetzt mit dem und gemeinschaftlich, über einen gewissen Zeitraum X, gehen wir dann alle zusammen zu Dorothee Bär und diskutieren das mal. Oder sagen Sie jetzt „Ich habe jetzt hier… Wir haben jetzt ein Papier. Ist ein Angebot. Macht was draus.
[00:55:19] Diethard Tautz:
[lacht]
[00:55:20] Diethard Tautz:
Und macht mal! Ne. Natürlich muss man an der Sache dranbleiben, das ist ganz klar. Und tatsächlich laufen im Hintergrund schon Gespräche. Aber da kann ich im Einzelnen noch nicht drauf eingehen.
[00:55:30] Doreen Siegfried:
Okay, wir werden davon erfahren.
[00:55:32] Konrad Förstner:
Ich muss sagen, die AG ist ja auch relativ gut aufgestellt, also hat Vertreter:innen aus verschiedenen Bereichen. Auch die angesprochene Allianz ist ja auch sehr breit aufgestellt. Das ist natürlich auch ein guter Anknüpfpunkt, der dann in die verschiedenen Organisationen Informationen und Ideen reintragen kann. Von daher sind wir schon ein bisschen weiter als noch vor ein paar Jahrzehnten, sagen wir es mal so, in dieser Art auch große Ideen vielleicht mal in die Breite zu tragen. Auch wenn das immer sehr mühselig ist und durch viele Sachen, Gremien erstmal durchgehen muss, haben wir damit ein gutes Standing. Man könnte sagen, dass DEAL zumindest organisatorisch natürlich ein Beleg dafür ist, dass man sich auch zusammen auf die Hinterbeine stellen kann und was ändern kann, ohne zu bewerten, ob das in der Art und Weise jetzt perfekt war. Aber die Möglichkeit, das zu machen, haben wir mittlerweile, weil sich die verschiedenen Organisationen zusammengerauft haben und vielleicht auch solche Ideen umsetzen.
[00:56:18] Doreen Siegfried:
Okay. Also die Akteure gibt es, die kennen sich auch alle. Wunderbar. Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen. Ich fand es furchtbar interessant und ich gehe fest davon aus, dass wir weiterhin noch von diesem Papier und von den nächsten Schritten hören, dass es auch in der Diamond Open Access Community diskutiert wird usw. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen.
[00:56:42] Doreen Siegfried:
Vielen Dank auch an Sie liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir hoffen, die Episode hat Ihnen gefallen. Teilen Sie uns gerne Ihre Meinung mit. Ob Lob oder konstruktive Kritik per E-Mail auf Mastodon, YouTube, Bluesky oder LinkedIn. Und wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns, wenn Sie uns abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie uns treu.